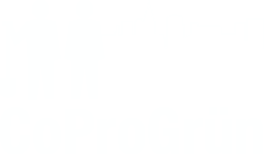
Co-produzierte Grünzüge als nachhaltige kommunale Infrastruktur
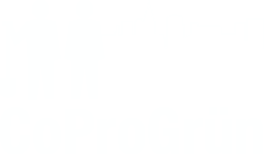
Co-produzierte Grünzüge als nachhaltige kommunale Infrastruktur
In CoProGrün wurden verschiedenste Instrumente zur Entwicklung erfolgreicher Co-Produktions-Projekte entwickelt und getestet. Unsere 13 erfolgreichsten Instrumente stehen hier zum Download bereit, um Sie bei der Realisierung Ihrer Projektideen zu unterstützen. Viel Spaß beim Stöbern!
Bienenweiden schaffen Nahrung und Lebensraum für Bienen und andere Insekten und sind ein Versuch, dem aktuell viel diskutierten Insektensterben zu begegnen. Sie können unterschiedliche Ausmaße haben und an unterschiedlichen Standorten realisiert werden. Grundsätzlich kommen sämtliche ungenutzten, brachliegenden Flächen in Stadt und Land in Frage. Bienenweiden entstehen, indem Saatgut mit insektenfreundlichen Blütenpflanzen ausgebracht und insektenfreundliche Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Die Anleitung beschreibt die einzelnen Arbeitsschritte, die beim Anlegen neuer Bienenweiden ausgeführt werden müssen und gibt einen Überblick, welche Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt erfüllt sein sollten. Sie richtet sich an Kommunen, Vereine, Institutionen und alle Personen, die Bienenweiden gemeinsam mit engagierten Bürgern anlegen möchten.
| Autor: | Ulrich Häpke |
| Dateigröße: | 696,5 KB |
Sie möchten Ihren Bauernhof für Besucher öffnen, Lebensmittel direkt vermarkten und dabei sicher gehen, dass alle Vorschriften und Belange der Sicherheit eingehalten werden?
In einem Modellprojekt untersuchten die CoProGrün Partner gemeinsam mit einer Expertin, welche Vorgaben bei der Direktvermarktung und der Planung eines Hofladens oder Hofcafés berücksichtigt werden müssen. Diese Informationen wurden zu einer Checkliste ausgearbeitet, die landwirtschaftliche Betriebe beim Aufbau eines eigenen Hofcafés oder Hofladens unterstützen soll. Die Liste informiert über Kennzeichnungspflichten, notwendige Versicherungen, Hygienevorschriften und bauliche Vorgaben in der Gastronomie. Außerdem enthält sie Auflistungen wichtiger Arbeitsschritte und Formularvorlagen zur Einhaltung der Hygienevorschriften.
| Autor: | Nils Rehkop |
| Dateigröße: | 1,38 MB |
Das Grünzug-Puzzle mit der Kartendarstellung des Untersuchungsraums kann bei größeren Akteurstreffen als „Icebreaker" eingesetzt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen das großformatige Puzzle gemeinsam zusammen und treten dabei spielerisch in Interaktion. Durch das Zusammensetzen des Puzzles beschäftigen sich alle Akteure mit dem Projektgebiet. Gleichzeitig wird eine große Karte als Diskussionsgrundlage zur Verfügung gestellt.
| Autor: | Katharina Christenn, Axel Timpe |
| Dateigröße: | 1,2 MB |
Der Grünzug-Taler kann bei größeren Veranstaltungen eingesetzt werden um Akteure zu vernetzen. Dieses spielerische Werkzeug lässt sich gut in den Austausch in ungezwungener Atmosphäre integrieren und sorgt dennoch für eine gewisse Verbindlichkeit.
| Autor: | Katharina Christenn, Axel Timpe |
| Dateigröße: | 688,91 KB |
Gemeinschaftlich betriebene Pilzzuchtanlagen können zur Aufwertung städtischer Quartiere beitragen. Sowohl die lokale Gastronomie als auch die Anwohner profitieren von lokal produzierten Speisepilzen, den entstehenden Bildungsangeboten und Beschäftigungsmöglichkeiten. In einem Modellprojekt untersuchte CoProGrün, welche technische Ausstattung und Infrastruktur für den Aufbau einer urbanen Speisepilzzuchtanlage erforderlich sind. Darauf aufbauend wurde eine Checkliste erarbeitet, die Kommunen, Vereine und Einzelpersonen bei der Wahl eines Produktionsstandortes helfen kann. Sie liefert wichtige Fakten zur Pilzzucht und benennt Kriterien, anhand derer überprüft werden kann, ob sich ein Raum für eine Pilzzuchtanlage eignet.
| Autor: | Nils Rehkop |
| Dateigröße: | 464,38 KB |
Um zielgerichtet Mitmacher für einen Gemeinschaftsgarten zu aktivieren, ist eine passende Ansprachemethodik notwendig. Die Checkliste führt wichtige Punkte und Fragen auf, die die Garteninitiativen bei der Entwicklung einer individuellen Ansprachemethodik leiten.
| Autor: | Carlos Tobisch |
| Dateigröße: | 450,52 KB |
In Gemeinschaftsgärten treffen Menschen mit verschiedenen Hintergründen aufeinander. Nicht immer sind gärtnerische Vorkenntnisse vorhanden. Jede Person hat individuelle Erwartungen an das gemeinsame Projekt. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist es daher wichtig, dass sich die Akteure von Anfang an offen über ihre Vorstellungen vom gemeinschaftlichen Gärtnern austauschen. Die Anleitung beschreibt ein Workshop-Format, das Gärtnergruppen selbstständig durchführen können, um gemeinsam ein Konzept für ihren Garten zu entwickeln. Sie gliedert den Prozess in einzelne Arbeitsphasen, schlägt Arbeitsmethoden vor und benennt Themenfelder die im Workshop diskutiert werden sollten: Inhalt und Gestalt, Zusammenarbeit und Gemeinschaft sowie Verantwortlichkeiten und Entscheidungen.
| Autor: | Carlos Tobisch |
| Dateigröße: | 1,05 MB |
Die Checkliste stellt konkrete Fragen zu den Themen Gestaltung, Gemeinschaft und Verantwortlichkeit, die neu gegründeten Garteninitiativen als Leitlinie bei der Entwicklung eines Konzepts für ihren Gemeinschaftsgarten dienen.
| Autor: | Carlos Tobisch |
| Dateigröße: | 448,41 KB |
Diese Anleitung zum Aufbau eines Gemeinschaftsgartens zeigt, welche Vorbereitungen für den Aufbau eines Gemeinschaftsgartens getroffen werden müssen und welche Rahmenbedingungen vor Projektbeginn überprüft werden sollten. Darüber hinaus kann sie den Gärtnergruppen als Leitfaden zur Entwicklung eines Konzepts sowie zum Aufbau und Betrieb des Gartens dienen. Die Checkliste richtet sich an Initiativen, die einen Gemeinschaftsgarten gründen möchten. Die einzelnen Schritte sind aufgelistet und mit Kästchen zum Abhaken versehen.
| Autor: | Carlos Tobisch |
| Dateigröße: | 453,82 KB |
Die Liste zeigt die einzelnen Aufgaben, die in der Organisation und Koordination, im Aufbau und im Betrieb eines Gemeinschaftsgartens anfallen. Sie hilft Gärtnergruppen, den Überblick über die notwendigen Arbeitsschritte zu behalten, Arbeitseinsätze im Garten zu Planen und Aufgaben gerecht zu verteilen.
| Autor: | Carlos Tobisch |
| Dateigröße: | 460,38 KB |
Wo verschiedene Akteure gemeinsam arbeiten, können Meinungsverschiedenheiten auftreten. Um Konflikte zu vermeiden, legen viele Gärtnergruppen gemeinsam Regeln für die Beteiligung, den Betrieb und die Ernte in ihrem Gemeinschaftsgarten fest. Das Beispiel aus dem CoProGrün Modellprojekt „Stadtteilgarten Deininghausen“ zeigt exemplarisch, wie ein Regelwerk für einen Gemeinschaftsgarten aussehen kann.
| Autor: | Carlos Tobisch |
| Dateigröße: | 465,42 KB |
Streuobstwiesen haben einen hohen ökologischen Wert. Dennoch werden viele der Flächen unzureichend gepflegt und ihr Baumbestand ist in schlechtem Zustand. Auf lokaler Ebene engagieren sich verschiedene Natur- und Umweltschutzgruppen in der Pflege und Nutzung einzelner Streuobstwiesen, aber die Akteure und ihre Aktionen sind kaum vernetzt. Um die Wahrnehmung von Streuobstwiesen zu steigern und die Akteure zu vernetzen, wurde die Online Plattform Streuobstwiesen entwickelt. Diese bietet Flächeneigentümern die Möglichkeit, Standorte von Streuobstwiesen auf einer digitalen Karte einzutragen (Kartierungstool). Aktive können in einem Forum auf ihre Veranstaltungen (z.B. Umweltbildungsangebote, Baumpflegekurse), Aktivtäten und Produkt-Angebote hinweisen (Informationstool). Interessierte können sich auf der Plattform informieren, vernetzen und so selbst aktiv werden (Vernetzungstool).
| Autor: | Denise Kemper |
| Dateigröße: | 568,51 KB |
Das Projekt-Poster ist ein niederschwelliges Instrument um Projektideen zu konkretisieren, in ein Präsentations-Format zu bringen, auf Veranstaltungen vorzustellen und neue Partner zur Umsetzung zu gewinnen. In Suche-/Biete-Feldern werden Angebote, Bedarfe und Mitmach-Möglichkeiten aufgezeigt, um Besucherinnen und Besuchern auf mögliche Anknüpfpunkte hinzuweisen.
| Autor: | Katharina Christenn, Axel Timpe |
| Dateigröße: | 1,17 MB |
Hier können Sie alle Instrumente zur Entwicklung erfolgreicher Co-Produktions-Projekte auf einmal runterladen.
| Autor: | CoProGrün |
| Dateigröße: | 6,06 MB |